Warum kommt es zu einer Stichwahl?
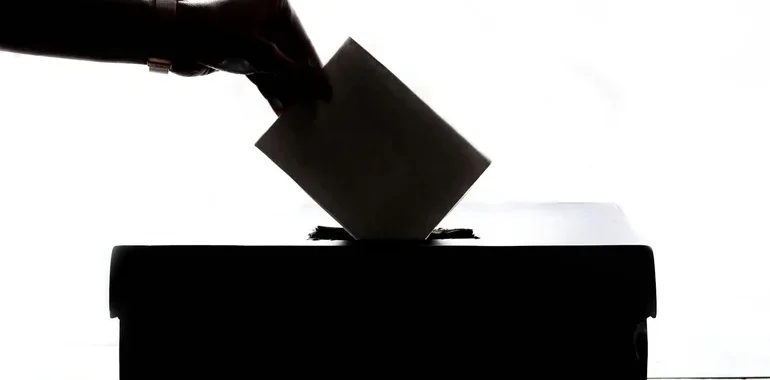
Warum kommt es zu einer Stichwahl?
In Wahljahren taucht eine Frage immer wieder auf: „Warum kommt es zu einer Stichwahl?“ Besonders bei Bürgermeister- oder Landratswahlen in Deutschland, manchmal auch in anderen politischen Systemen, liest man nach dem ersten Wahlgang: Es gibt keinen klaren Sieger, also folgt eine Stichwahl. Doch was steckt dahinter?
Die Stichwahl ist kein exotisches Extra, sondern ein wichtiges Instrument der Demokratie. Sie stellt sicher, dass die gewählte Person von einer Mehrheit der Wählerinnen und Wähler getragen wird. Damit geht es nicht nur um mathematische Mehrheiten, sondern auch um Legitimation, Vertrauen und Stabilität in politischen Ämtern.
Was ist eine Stichwahl?
Eine Stichwahl ist ein zweiter Wahlgang, der nur dann durchgeführt wird, wenn im ersten Durchgang niemand die erforderliche Mehrheit erreicht hat. Dabei treten nur noch die beiden Kandidierenden mit den meisten Stimmen an.
Das Prinzip ist einfach:
- Niemand schafft die absolute Mehrheit (> 50 %) im ersten Wahlgang.
- Die beiden bestplatzierten Kandidierenden bleiben übrig.
- Im zweiten Wahlgang entscheidet sich endgültig, wer das Amt übernimmt.
Wer die zweite Wahl gewinnt, hat somit immer die Mehrheit der Stimmen hinter sich.
Eine detaillierte Definition findest du auch im Politiklexikon.
Absolute Mehrheit vs. relative Mehrheit
Um zu verstehen, warum es überhaupt Stichwahlen gibt, lohnt sich der Blick auf den Unterschied zwischen absoluter und relativer Mehrheit.
| Mehrheitstyp | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| Absolute Mehrheit | Mehr als 50 % aller gültigen Stimmen | Kandidat A: 51 %, Kandidat B: 49 % |
| Relative Mehrheit | Der oder die mit den meisten Stimmen gewinnt, auch wenn es unter 50 % sind | Kandidat A: 38 %, Kandidat B: 35 %, Kandidat C: 27 % → A gewinnt |
In Deutschland gilt für viele Direktwahlen das Prinzip der absoluten Mehrheit. Dadurch kommt es häufig zu Stichwahlen – besonders dann, wenn mehrere Personen antreten und die Stimmen stark verteilt sind.
Warum kommt es zu einer Entscheidungswahl?
1. Legitimation sichern
Politische Ämter wie Bürgermeister oder Landräte haben direkten Einfluss auf das Leben der Menschen vor Ort. Damit eine gewählte Person nicht nur von einer kleinen Minderheit unterstützt wird, soll sie mindestens die Hälfte der Stimmen erreichen. Ein zweiter Wahlgang sichert diese Legitimation.
2. Zersplitterung der Stimmen
Oft bewerben sich mehrere Kandidierende. Selbst wenn eine Person deutlich vorne liegt, reicht es nicht automatisch zur absoluten Mehrheit. Beispiel:
- Kandidat A: 40 %
- Kandidat B: 32 %
- Kandidat C: 28 %
Hier hat niemand über 50 %. Eine Wahl zwischen A und B sorgt für eine klare Entscheidung.
3. Demokratischer Gedanke
Die Wählerinnen und Wähler sollen nicht das Gefühl haben, dass jemand „durchrutscht“. Der weitere Wahlgang gibt der Bevölkerung eine zweite Chance, sich zwischen den Favoriten zu entscheiden.
Wo gibt es Stichwahlen in Deutschland?
Diese sind vor allem bei Direktwahlen von Personen üblich. Dazu gehören:
- Bürgermeister- und Oberbürgermeisterwahlen
- Landratswahlen
- teilweise auch Landtags- oder Präsidentschaftswahlen (in anderen Ländern oder in der Vergangenheit)
Bei Parlamentswahlen – Bundestag, Landtage oder Stadträte – gibt es dagegen keine Stichwahlen. Hier gilt das Prinzip der relativen Mehrheit.
Ein internationaler Vergleich
Deutschland ist nicht das einzige Land mit Stichwahlen. Auch andere Länder nutzen dieses Instrument:
- Frankreich: Bei den Präsidentschaftswahlen gibt es immer zwei Wahlgänge. Der erste sortiert die Kandidierenden, der zweite bringt die endgültige Entscheidung.
- Österreich: Bei der Wahl des Bundespräsidenten findet ebenfalls eine Stichwahl statt, wenn niemand im ersten Durchgang die absolute Mehrheit erreicht.
- USA: Dort gibt es keine klassische Stichwahl auf Bundesebene, aber in manchen Bundesstaaten werden sogenannte „Runoff Elections“ eingesetzt.
Andere Länder setzen auf Alternativen, z. B. das Instant-Runoff-Voting, bei dem Wähler ihre Stimmen nach Präferenz vergeben.
Politische und gesellschaftliche Bedeutung
Dieses Instrument ist nicht nur eine technische Lösung für das Mehrheitsproblem, sondern auch Ausdruck des demokratischen Prinzips. Sie zeigt, dass Mehrheiten verhandelt und gefunden werden müssen.
Das passt gut zum Thema soziale Rollen: Auch in der Politik nehmen Menschen bestimmte Rollen ein – als Wähler, Kandidat oder Amtsinhaber. Die Stichwahl zwingt alle Beteiligten, sich mit diesen Rollen auseinanderzusetzen und ihre Positionen klarer zu formulieren.
Gleichzeitig beeinflusst die Art, wie wir Mehrheiten definieren, unser Weltbild. Ob man relative Mehrheiten akzeptiert oder eine absolute Mehrheit fordert, sagt viel über die politische Kultur eines Landes aus.
Fun Facts
- In Nordrhein-Westfalen wurde die Stichwahl für Bürgermeisterwahlen 2007 abgeschafft, 2020 aber wieder eingeführt. Grund: Manche Bürgermeister wurden mit unter 40 % gewählt – das galt vielen als zu wenig Rückhalt.
- In Frankreich ist es fast unmöglich, die Präsidentschaft ohne Stichwahl zu gewinnen. Die politische Landschaft ist dort so vielfältig, dass im ersten Wahlgang selten jemand über 50 % kommt.
- Sie können überraschende Wendungen bringen: Kandidaten, die im ersten Wahlgang klar vorne lagen, verlieren manchmal im zweiten Durchgang, weil sich die Unterstützer der ausgeschiedenen Kandidaten zusammenschließen.
Kritik an Stichwahlen
Auch wenn die Stichwahl demokratisch sinnvoll erscheint, gibt es Kritikpunkte:
- Kosten: Ein zweiter Wahlgang bedeutet mehr Aufwand und zusätzliche Ausgaben für Städte und Gemeinden.
- Wahlmüdigkeit: Die Beteiligung ist in Stichwahlen oft deutlich niedriger, weil viele Menschen ihre Stimme bereits im ersten Durchgang abgegeben haben.
- Polarisierung: Da nur zwei Kandidaten übrigbleiben, kann sich die politische Debatte verhärten. Grautöne verschwinden, Schwarz-Weiß-Denken nimmt zu.
Fazit: Klarheit durch die Stichwahl
Eine Stichwahl kommt dann zustande, wenn im ersten Wahlgang niemand die absolute Mehrheit erreicht. Sie sorgt dafür, dass die gewählte Person von einer breiten Mehrheit getragen wird und stärkt die demokratische Legitimation.
Obwohl sie manchmal kritisiert wird, erfüllt die Stichwahl eine wichtige Funktion: Sie schafft Klarheit, vermeidet „Durchrutscher“ und zwingt Kandidierende dazu, um Mehrheiten zu werben. In einer Demokratie, die von Mitbestimmung lebt, ist das ein starkes Signal.
Foto von Element5 Digital

